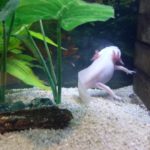Ein Eintrag, ein Eintrag!
Jetzt wird es aber mal endlich Zeit, die letzten Reiseschilderungen zu tätigen! Ich grüße euch, liebe Blogleserinnen und Blogleser, liebe Weltenbummlerkollegen und solche, die es werden wollen, sowie überhaupt alle, die sich hierher verirrt haben. Die drei Monate Jamaika haben Spuren hinterlassen. Moskitonarben, braune Haut, Braids im Haar, aber auch innerlich bin ich immer noch recht aufgewühlt und mein Redebedarf ist definitiv erhöht. Kontinuierlich nimmt jedoch jeder „Also in Jamaika war das ja soundso“-Satz jedoch bereits ab und ich merke, dass Tag für Tag bereits Kleinigkeiten in Vergessenheit geraten. So ein Blog kann dem definitiv entgegenwirken.
Dennoch möchte ich euch diesmal nicht von Jamaika erzählen, sondern von meiner anschließenden Reise berichten. Fünfzehn Tage lang hielt ich mich nämlich in den Staaten auf. The United States of America – das Land der schier unendlichen Möglichkeiten, weiten Distanzen, lecker Essen, dicken Menschen und komischen englischen Dialekten. Für meine erste USA-Reise kann ich stolz berichten, einige tolle Dinge erlebt zu haben. Von Touri-Programm bis wagemütigen Tramping-Erfahrungen war diesmal alles dabei, sodass mir dieser Aufenthalt definitiv in Erinnerung bleiben wird.
1 MoBay – Houston
Meine Reise führte mich zunächst in das bereits im letzten Beitrag erwähnte Houston, Texas. Eigentlich wollte ich ja nach Albuquerque, doch musste ich in Houston einen Zwischenstopp über Nacht machen, weil die Flüge zeitlich so ungünstig waren, dass ich nicht an ein und demselben Tag von MoBay nach Albuquerque fliegen konnte. Um den Aufenthalt so kostengünstig, aber auch so spaßig wie möglich zu machen, hatte ich bereits Anfang März eine Anfrage bei Couchsurfing für Houston gestellt. Und tatsächlich meldete sich ziemlich schnell der Inder Madhan (sprich: Maddin), der mich supernetterweise sogar vom Flughafen abholte! Wir kamen schnell und einfach ins Gespräch, ich musste nur erwähnen, dass ich was mit Musik studierte, und schon erhielt ich einen ausgiebigen Vortrag über die besten indischen zeitgenössischen Komponisten der letzten Jahrzehnte. Huiii, da war also gleich der nächste Kulturschock! Frisch von der Reggae-Insel bekam ich die halbe Autofahrt also indische Musik zu hören, die sich jetzt für mein Ohr nicht allzu sehr von jeder herkömmlichen Bollywoodmusik unterschied. Dennoch freute ich mich über diesen abrupten Musikwechsel.
Wir gingen einkaufen, fuhren in sein süßes, ruhiges Appartement und er zeigte mir sein Gästezimmer. MEIN Zimmer – das erste Mal seit dem 3. Januar hatte ich ein Schlafzimmer ganz für mich allein! Da kam man sich direkt einsam vor, aber ich genoss es natürlich ausgiebig! Er machte etwas indisches zu essen und wir hatten einen interessanten Abend voller Plausch und Tratsch und Tequila. Tatsächlich hatte ich mit diesem vielleicht Ende 30-jährigen Inder eher Frauengespräche als alles andere, aber wir hatten viel Spaß daran und ich werde ihn definitiv in guter Erinnerung behalten.
Am nächsten Morgen hatte ich das wohl amerikanischste Frühstück, das ich hätte essen können: Peanut Butter Jelly. Mit anderen Worten: man schmiert sich ein Sandwich aus einer großen Portion Erdnussbutter und einer ordentlichen Schicht Marmelade drauf. Gegen Mittag brach ich dann Richtung Airport auf, um endlich nach Albuquerque zu gelangen!
2 Houston – Albuquerque (sprich: ‚älbək’örkie :D)
Endlich flog ich nun zu meinem eigentlichen Zielort. Was hat sie denn dort in der Wüste gemacht, fragt ihr euch vielleicht? Ich habe eine Verwandte besucht! Katrina ist eine ‚Cousine zweiten Grades‘, und als ich ihr im Oktober/November schrieb, ob ich sie nicht für eine Zeit lang besuchen könnte, war sie auch ganz angetan von der Idee und so ergab sich der USA-Trip ganz unkompliziert. Nach einem etwas luftlöchrigen Flug holte mich ihr Freund vom winzigen Airport ab und fuhr mich gleich eine Weile durch die Gegend, was super war, denn Katrina musste leider während meines Aufenthaltes arbeiten und so konnte ich gleich etwas Orientierung gewinnen, da ich doch hauptsächlich allein die Stadt erkunden würde. Albuquerque ist vor allem als Drehort für Filme und Serien bekannt geworden, unter anderem Transformers und Breaking Bad. Da ich die Frage schon mehrmals bekommen habe: Nein, ich habe keine Pizza auf das Dach des Hauses von Walter White geworfen!
Katrina wohnt schon seit 9 Jahren in den USA, arbeitet als Stadtplanerin und war daher perfekte Ansprechpartnerin nicht nur für Albuquerque, sondern auch für New Mexico und die Staaten überhaupt. Nachdem ich mein Zeug bei ihr abgelegt hatte, fuhren wir zu diversen Brauereien und Restaurants, um etwas zu essen und zu trinken. Kulinarisch hat New Mexico einiges zu bieten, und wer es scharf und mexikanisch mag, ist hier genau richtig! Außerdem hat Albuquerque viele eigene Brauereien, sodass man auch als Bierfan auf seine Kosten kommt. So ging der erste Tag in ABQ gut gesättigt und bierig zu Ende.
Die ersten Wochentage (meine Ankunft war an einem Montag) hatte ich für mich, um die Stadt zu erkunden. Nach der ganzen Fliegerei genoss ich es am ersten Tag Spazieren zu gehen und wanderte tatsächlich ganze 15 Kilometer lang allein durch die Stadt, welche übrigens knapp 600’000 Einwohner hat. Albuquerque hat auch ein paar historische Gebäude und Plätze, zum Beispiel das romantische, kitschig dekorierte KiMo-Theater (wo angeblich der Geist eines verstorbenen Kindes sein Unwesen treibt) und Old Town, der Stadtteil, in welchem viele Lehmhäuser („Adobe buildings“) mit kleinen hübschen Touri-Läden um einen Plaza mit Kirche stehen. Ganz groß geschrieben wird in New Mexico die indianische Vergangenheit … und Gegenwart. Das ist auch in den Souvenirläden nicht zu übersehen: Indianische Glücksbringer, Schmuck, Spielzeuge, und vieles mehr.
An einem Tag bin ich mit dem „Rail Runner“ (ein Pendelzug, dessen Tempo im Vergleich mit der deutschen Bahn wohl eher einer Bimmelbahn gleicht) nach Santa Fe gefahren. Der Zug hatte mehrere Zwischenhalte in Pueblos, also Indianersiedlungen, die mir jedoch nicht sehr spannend erschienen. Santa Fe ist wesentlich kleiner als Albuquerque, jedoch die Hauptstadt von New Mexico und sieht so hübsch und indianisch aus wie der Old Town-Stadtteil, nur diesmal als ganze Stadt! Außerdem war ich dort in der ältesten Kirche der USA, das war schon beeindruckend. Eine Galerie mit Kunstobjekten jeglicher Art von Native Americans führte mir lebhaft vor Augen, wie aktuell doch noch die Probleme der Menschen mit indianischen Wurzeln in den Staaten sind und dass sie vor allem alles andere als Begeisterung für den derzeitigen Präsidenten aufbringen.
An anderen Tagen ging ich in Museen oder Coffee Stores, in Second Hand Läden oder in den Zoo. Was war das doch für ein gewaltiger Unterschied zu Jamaika! Von Holocaust-Museen über eine Ausstellung zu Klapperschlangen, einem naturwissenschaftlichen Kindermuseum bis zu Dinosaurier-Skeletten war alles dabei! Es gab so vieles zu entdecken, hier konnte man richtig Kultur erleben und nicht nur Reggae hören. Versteht mich nicht falsch, ich habe Jamaika so wahnsinnig lieb gewonnen, doch eine gewisse Eintönigkeit in der Zeit dort ist mir erneut in den Staaten so richtig bewusst geworden.
Am Wochenende hatte Katrina frei und wir machten zwei wundervolle Ausflüge. Am Samstag paddelten wir mit ihrem Freund drei Stunden auf dem Rio Grande entlang. Es war unglaublich sonnig, sodass meine Befürchtung, meine Jamaika-Bräune würde in den USA verblassen, völlig unbegründet war. Der Rio war kurvenreich und zog an schönen Häusern, Vogelbrutplätzen und allerlei Getier vorbei, hatte aber gar nicht so viel Wasser, also mussten wir sehr aufpassen, dass wir nicht irgendwo stecken blieben und bekamen jedes Mal Panik, wenn das aufblasbare Kayak hörbar an Steinen entlang schleifte. Es blieb aber dank Katrinas brillanter Lenktechnik alles heile.
Am Sonntag fuhren wir nach Taos. Dort leben ganz schön verrückt aussehende Menschen (also bin ich mit meiner Frisur nicht aufgefallen :D), denn dieser Ort wurde im legendären „Summer 69“ von vielen Hippies aufgesucht und einige schienen dort sesshaft geworden zu sein. Taos hatte eine unglaublich beeindruckende Schlucht zu bieten! Eine Brücke führte über diese, sodass wir den gewaltigen Erdenschlund mühelos zu Fuß, jedoch mit Respekt vor der Tiefe überqueren konnten. Vor dem Besuch der Schlucht holten wir uns Enchiladas und verspeisten diese auf einer windgeschützten Sitzbank direkt am steilen Abgrund. Das war wohl die beeindruckendste Kulisse, die ich je zu einem Mittagsmahl hatte.
3 Albuquerque-> Flagstaff -> Grand Canyon -> Flagstaff -> Albuquerque
In meiner zweiten USA-Woche stand vor allem eine Sache im Vordergrund: die Möglichkeit, einen Ausflug zum Grand Canyon zu machen! Eigentlich hatte ich vor der Organisation meiner USA-Reise überhaupt nicht daran gedacht, dass ich das tatsächlich von Albuquerque aus machen könnte. Doch nach einem Blick auf die Landkarte und dann kurzer Beratung mit Katrina schien es gar nicht so unmöglich. Da ich kein Auto mieten wollte, buchte ich den sogenannten Greyhound-Bus, der in 6 Stunden von Albuqueruque nach Flagstaff fuhr, was die nächst größere Stadt zum South Rim des Canyons ist. Als Unterkunft schien es mir am sinnvollsten, im Grand Canyon International Hostel zu übernachten, weil ich annahm, dass man dort einfach Leute kennenlernen konnte. Und so war alles für die Grand Canyon Tour organisiert, oder so fühlte es sich zumindest an.
Am Dienstag stand ich frühs gegen halb sieben auf, um den Greyhound zu erwischen, der 8 Uhr von der Bus Station losfahren sollte. 7.45 Uhr erschien ich dort … und wartete … und wartete …. und nichts geschah. Mensch, das ging ja gut los mit den Busverspätungen, hier scheinen sich ja jamaikanische Verhältnisse eingenistet zu haben. Nach einer halben Stunde fragte ich dann mal nach, ob ich was verpasst hätte. Ja, es hätte eine Durchsage gegeben, der Bus habe mindestens 4 Stunden Verspätung. 4 Stunden! So ein Mist, das heißt, bei meiner 6-Stunden-Fahrt, dass ich sicherlich nicht mehr am Nachmittag, sondern eher am frühen Abend in Arizona ankomme. Immerhin hatte Greyhound für seine Fahrgäste eine Entschädigung für die Verspätung. Und zwar gab es einen Burrito geschenkt. Wow, ich war… enttäuscht 😀 Also hatte ich alle Zeit der Welt, zurück zu Katrinas Appartment zu gehen, mir einen Tee zu kochen und gegen Mittag wieder zur Bus Station zu gehen. Letztendlich handelte es sich um fünfeinhalb Stunden Verspätung und gegen 13.45 Uhr ging es dann endlich, endlich los. Dementsprechend waren wir leider erst gegen 20 Uhr in Flagstaff. Zum Glück hatten wir in Arizona schon wieder eine andere Zeitzone, sodass ich eigentlich um 19 Uhr ankam und gegen 19.30 im Hostel landete, welches wirklich cool war und es einem sehr einfach machte, coole Leute zu treffen. Nun stellte sich mir zunächst die Frage: wie am folgenden Tag in den 80 Meilen entfernten Grand Canyon National Park gelangen? Da ich meinen Ein-Tages-Ausflug zum Grand Canyon noch kein bisschen geplant hatte und keine Lust hatte, den teuren Arizona Shuttle zu buchen, versuchte ich mein Glück mit der Idee, jemanden im Hostel zu finden, der eventuell auch am nächsten Tag zum Canyon möchte und der mich mitnehmen konnte. Es war doch gleich der erste Hostelgast, mit dem ich ins Gespräch kam, der – mit Mietwagen – auch am nächsten Tag zum Canyon wollte und noch dazu ein unglaublich netter Australier war, mit dem Namen Rusty. Ich konnte mein Glück kaum fassen, doch wie sich am nächsten Tag herausstellte, sollte ich noch viel mehr Glück haben…
Am nächsten Tag genossen wir ein ausgiebiges Hostelfrühstück und fuhren kurz nach 9 Uhr los Richtung Canyon in Rustys gemieteten Chevrolet. Nach anderthalb Stunden System of a Down und Dream Theater (denn Rusty und ich hatten auch noch den gleichen Musikgeschmack – Jackpot!) waren wir dann endlich am Grand Canyon. Ausgerüstet mit Wasser, Sandwiches und Obst waren wir bereit, das unglaubliche Naturspektakel zu bewundern. Wandern im Grand Canyon ist gefährlicher als man denkt, denn viele überschätzen ihre Fähigkeiten schnell. Es ist recht windig dort, vor allem im April, sodass man durch Tragen von Jacken und Tuch gar nicht merkt, wie viel Wasser man eigentlich verliert. Außerdem befindet man sich recht weit über dem Meeresspiegel und vergisst jedoch im schnellen Wanderschritt, dass das Atmen um einiges schwerer fällt als an anderen Orten. Eine schöne Formulierung habe ich dazu auf einer anderen Webseite gefunden: „About 250 people are rescued from the Grand Canyon each year, often the result of improper planning and/or making dumbass decisions“. Rusty und ich übertrieben es jedenfalls nicht. Der Wanderpfad den wir einschlugen, der Rim Trail, ging einfach an der großen Schlucht mit vielen Zwischenstopps entlang. Alle ein, zwei Kilometer hatte man die Möglichkeit, seine Wasserflasche aufzufüllen, einen Kaffee zu trinken oder ein neues Sandwich zu kaufen. Wir genossen den surrealen Ausblick in die Ferne. Es sah fast wie gemalt aus, so fern und doch zum Greifen nah. Der Meilen weite Blick über die Felsen gab uns das Gefühl, dieses Naturphänomen nie ganz erfassen zu können. Gleichzeitig erstreckte sich über dieses pompöse Gebilde eine imposante Ruhe, die allein durch die Geräuschkulisse der vielen Touristen ab und an unterbrochen wurde. Zum Glück war das Gedränge nie besonders groß, der riesige Park erstreckt sich schließlich kilometerweit in sämtliche Himmelsrichtungen.
Leider musste Rusty am selben Tag noch Richtung Las Vegas fahren, er brach also gegen Mittag wieder auf. Ich wanderte also alleine weiter den Trail entlang, optimistisch genug zu denken, dass ich sicherlich am Ende des Tages eine Möglichkeit der Rückreise finden würde, und wenn ich trampen müsste. Ich wanderte noch eine ganze Weile am Rim entlang und machte ein Bild nach dem anderen, aß meine Sandwiches und führte mit einigen Wanderern den üblichen „wow, cool hier“ – Smalltalk. Als ich keine Lust mehr auf das Wandern am Abhang hatte, setzte ich mich in einen der kostenlosen Shuttlebusse und fuhr zu einem großen Aussichtspunkt, wo ich meine Flasche auffüllte und überlegte, wie ich den Rest des Aufenthaltes gestalten sollte. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es reicht mir nicht mit dem Canyon. Ich musste ihn auch noch eine Weile hinunter gewandert sein, um meinen Ausflug als zufriedenstellend empfunden zu haben. Also fuhr ich mit dem Shuttle zurück zu einem Aussichtspunkt, bei dem es möglich war, einen anderen Trail hinein in den Canyon zu wandern, den Bright Angel Trail. Eine halbe Stunde wanderte ich diesen Pfad entlang, und es lohnte sich unglaublich: Es gab mir das Gefühl, dem Canyon viel näher zu sein, und der Ausblick blieb weiterhin fantastisch! Es wurde jedoch später und später, also wanderte ich bergauf zum Shuttlebus zurück (und ja, es war unglaublich anstrengend!) und fuhr zu den Parkplätzen. Ich wollte ja unbedingt die 80 Meilen nach Flagstaff trampen, also stellte ich mich an die Ausfahrt und hielt den Daumen raus. Nach einer Weile realisierte ich, dass ich anscheinend zu spät mit dem Trampen begonnen hatte, denn die Parking Areas waren viel leerer, als ich erwartet hatte. Es war bereits 18 Uhr und ich war der festen Überzeugung, dass bestimmt einige Gäste des Parks in Flagstaff übernachten und mich sicherlich bald jemand mitnehmen würde. Ich wanderte noch ein Stück die Straße entlang bis ich sicher gehen konnte, dass auch wirklich die Ausfahrten aller Parkplatzstellen an meinem Standpunkt vorbei gingen, und hielt erneut den Daumen raus. Nach knapp 20 Minuten hielt ein Mietwagen mit drei gut gelaunten Franzosen, die ganz begeistert waren, jemanden mitnehmen zu können. Leider fuhren sie nur zehn Minuten ins nächste Kaff ‚Tusayan‘, denn dort war ihr Hotel. Erneut hielt ich den Daumen raus, diesmal dauerte es keine fünf Minuten, da saß ich in einem Mustang bei zwei Niederländern, die ganz begeistert waren, eine Tramperin dabei zu haben und erst mal eine Reihe Selfies mit mir machten. Diese zwei Herrschaften fuhren mit ihrem schicken Sportwagen jedoch auch nur ins übernächste Kaff ‚Valle‘, wo sie ebenso in ihr Hotel einkehrten. Es war bereits 19 Uhr als wir dort ankamen und ich musste den Daumen nun in der Dämmerung raushalten. In Valle gab es nichts außer ein paar Häusern, einem Hotel und einer Tankstelle. Ein Straßenschild machte mir deutlich, dass ich noch 60 Meilen vor mir hatte, und langsam wurde mir klar, dass der Plan mit dem Trampen so spät am Abend vielleicht nicht die beste Idee war. Nach 15 Minuten Daumen raus ging ich zu einer Tankstelle in der Nähe und bat den sehr netten Verkäufer um ein Stück Pappe und einen Stift, um mein Ziel ausschildern zu können.
Erneut stand ich wieder an der Straße und es wurde immer dunkler, ich wartete und wartete, bis ich dann komplett im Dunkeln stand und mich nur noch die heran nahenden Autos mit ihren Scheinwerfern beleuchteten. Toll Claudia, dachte ich mir, wirklich prima, allein im Dunkeln auf einer eher schlecht als recht befahrenen Straße stehst du, fast 100 Kilometer von deinem Hostel entfernt, an einem Ort, der gerade mal ein Hotel und eine Tankstelle hat. Als es mir dann kurz nach acht zu blöd wurde, ging ich in das Hotel, was gleichzeitig ein Restaurant hatte und fragte die Gäste, ob zufällig jemand von ihnen noch nach Flagstaff fahren würde. Natürlich verneinten alle meine Frage und ich verließ das Gebäude, bevor die Hotelmitarbeiter mich rausschmeißen konnten. Leicht verzweifelt gab ich frustriert und leicht verfroren meinen Plan auf und ging wieder zur Tankstelle zu dem netten Verkäufer. Mir blieb wohl nichts anderes übrig, ihn zu fragen, ob ich von seinem Handy aus mir ein Taxi rufen könnte, was mich ganze 100 Dollar gekostet hätte. Und wie ich da so den Verkäufer gerade nach seinem Handy fragen will, merke ich, wie jemand an der Tankstelle meinen Worten lauscht und auf einmal langsam zu mir sagt: „You’re very lucky. You are very, very lucky tonight!“ Nun, wie sich herausstellte, musste ein Verwandter der Tankstellenbesitzerin tatsächlich noch am selben Abend nach Flagstaff fahren, um seinen Bruder vom Flughafen abzuholen. Ich bin schier aus allen Wolken gefallen vor Freude! Auch die Besitzerin der Tankstelle war froh, dass der Fahrer nun eine Begleitung hatte: „Now I’m glad to know that he won’t fall asleep while driving!“ Jessie, so hieß der junge Mann, fuhr mich tatsächlich mit seinem „Black Death“ (so nannte er seinen Land Rover, mit dem er schon mehrere Elche und Kojoten aus Versehen überfahren hatte) sogar vor die Tür meines Hostels. Ich war unglaublich erleichtert, als ich in mein Bett fallen konnte. Auch die anderen Hostelgäste waren erstaunt von meiner Geschichte, und eine Zimmergefährtin zeigte mir darauf einen handgroßen Elektroschocker, den sie immer dabei habe und womit sie sich sicherer fühle. Obwohl ich fix und fertig war, schlief ich die Nacht richtig schlecht, weil ich einfach so sauer auf mich und diese Trampingaktion war. Ich schwor mir, nie wieder mein Glück so arg herauszufordern und so spät alleine zu trampen, nie wieder! So gut kann es im Leben nicht immer ausgehen, es wäre einfach dumm, das zu erwarten!

Am nächsten Morgen hatte ich genügend Zeit, um Flagstaff noch eine Weile zu erkunden. Dieses Städtchen ist definitiv sehenswert mit seinen rustikaleren Häusern, einem großen Universitätskomplex sowie kleinen Parks und Wäldchen am Stadtrand. Wer sich für Astronomie interessiert, ist mit dem dortigen Observatorium sicherlich zu begeistern. Von dort wurde nämlich Pluto im Jahre 1930 entdeckt. Ich war allerdings so unglaublich müde vom Vortag, dass ich nur eine kleine Runde in der Stadt drehte, mich dann für ein Stündchen in einem Café ausbreitete und dann Richtung Busbahnhof stiefelte. Wenigstens war der Bus auf meiner Rückfahrt pünktlich, sodass ich kurz vor 22 Uhr wieder in Albuquerque eintrudelte.

4 Albuquerque – New York City
Für meinen Rückflug hatte ich eine ganz besondere Route geplant. Über Nacht ging es vom süßen kleinen Sunport New Mexico zum Big Apple, wo ich ganze 17 Stunden Aufenthalt hatte und somit genügend Zeit, um in der Stadt ein paar Sehenswürdigkeiten zu erblicken. Der Flug dauerte nur 4 Stunden, doch weil ich 2 Zeitzonen überquerte, kam ich in New York frühs um 7 an, obwohl wir gegen 1 in Albuquerque losflogen. Erstaunlich munter stieg ich aus dem Flugzeug, schloss meinen Koffer ein, kaufte eine Metro Card und fuhr Richtung Manhattan, lustigerweise mit einmal umsteigen über die Jamaica Station, wie passend.
Zu meiner großen Freude war es mir möglich, meine liebe Freundin Annemarie in New York zu treffen! Sie arbeitet als Au Pair in Washington D.C. und kam extra in die Stadt, damit wir den Tag gemeinsam verbringen konnten. Zunächst genossen wir ein Frühstück in einem Restaurant mit dem abgefahrenen Namen „the Butcher’s Daughter“. Danach ging es weiter durch diesen beeindruckenden Teil der Stadt, wir blieben den ganzen Tag in Manhattan. Ich hatte das besondere Erlebnis, vor dem 9/11-Memorial zu stehen. Zwei riesige quadratische Löcher, in denen Wasser in die Tiefe rinnt, umgeben von einem Gelände, an dem die Namen der Verstorbenen stehen. Da wird einem ganz mulmig zumute. Auch andere Berühmtheiten bekamen wir zu Gesicht: Das Empire State Building, die Freiheitsstatue und den Central Park. Außerdem waren wir auf dem lebhaften Times Square. Interessant war, dass sich dort überhaupt nicht meine Vermutung bestätigte, es würde dort sehr laut vonstatten gehen. All die Bilder und Videos, die ich über jenen Square gesehen hatte, stellte ich mir mit einer ungeheuren Geräuschkulisse vor, sicherlich durch die vielen glitzernden, sich bewegenden Reklamen. Dabei war es dort, außer dem Gerede der Touristen und dem Hupen der Taxis, nicht besonders laut auf der Straße und der großen Treppe, von der aus man das Spektakel beobachten kann.
Eine Sache trübte jedoch unseren New York Day: es herrschte Eiseskälte! Nach meinen warmen Tagen in Albuquerque mit gut 20 Grad hatten wir in New York Regen, am Abend sogar richtige Schauer, bei ungemütlichen 8 Grad Celsius. Daher gestaltete sich unsere Manhattan-Sightseeing-Tour ungefähr so: eine Sehenswürdigkeit abklappern -> ins nächste Café flüchten -> wieder raus und etwas anschauen -> ab ins nächste Café und den nächsten warmen Tee trinken (außer man ist zu blöd für Starbucks wie ich und bestellt einen kalten Tee mit Eiswürfeln – brrrrr!) -> auf zur nächsten Sehenswürdigkeit und danach schnell in die nächste Teestube und so weiter. Uns störte das nicht allzu sehr, hatten wir uns doch eine ganze Weile nicht gesehen und konnten so schön in den Teepäuschen ausgiebig quatschen. In Erinnerung wird uns außerdem die verzweifelte Suche nach einer Toilette bleiben! Liebe New Yorker, wo bitte geht man denn in der 7th, 8th Avenue oder der 34th Street auf’s Klo? Wir sind mindestens eine halbe Stunde umher gelaufen, in 3,4 verschiedene Restaurants und Cafés rein, manche mit verstopften Toiletten oder andere ohne WC – es schien uns schier unmöglich, diese Porzellanschüssel der abgeschotteten Art zu finden. Schließlich versuchten wir es in einem ziemlich schicken Einkaufszentrum, wo wir zum Glück fündig wurden (obwohl wir dank Labyrinth artiger Schilderführung einmal falsch abbogen und umkehren mussten :D)
Als ich Annemarie am Abend zu ihrem Bus brachte und mich auf den Rückweg zur Subway Richtung Airport machte, goss es wie aus Strömen und ich wurde einmal völlig von oben bis unten durchnässt. Bibbernd hielt ich tapfer die anderthalb Stunden Bahn durch, bis ich am Terminal meinen Koffer abholen konnte und ich somit die Möglichkeit hatte, mich einmal komplett neu einzukleiden. Meine Turnschuhe musste ich an diesen Handtrocknern im Ladies Rest Room eine gute Viertel Stunde lang trocken föhnen, was bestimmt sehr lustig aussah und sicherlich das Naserümpfen der Toilettengänger erklärte. Dann endlich, nach einem unkomplizierten Check in und Personenkontrolle stieg ich in meinen vorletzten Flieger, um – erneut über Nacht fliegend – den großen Tümpel zu überqueren, der Amerika von Europa trennt.
5 New York City – Oslo – Berlin
Nach einem unkomplizierten 7-h-Flug mit beachtlich viel Schlaf kam ich dann in Skandinavien an, Ortszeit 13 Uhr. Es lag Schnee auf den Straßen, weshalb ich beschloss, meinen fünfstündigen Aufenthalt nur im Flughafengebäude zu verbringen, in die Stadt zu fahren erschien mir eh zu kurz dafür. Durch eine lange Personenkontrolle, das zweimalige Verlegen des Gates und meiner wachsenden Müdigkeit vergingen die fünf Stunden Aufenthalt wie im Flug (haha, denn von Fliegen hatte ich jetzt besonders viel Ahnung!) und ich trottete zu meinem letzten Flugzeug, welches mich endlich, endlich nach Berlin bringen sollte. Als ich auch dort problemlos meinen Koffer entgegen nehmen konnte und zum Ausgang lief, wartete dort meine schmerzlich vermisste bessere Hälfte bereits, sodass die Müdigkeit verflog. Die zweistündige Heimfahrt nach Leipzig war total entspannt und ich fiel nur noch ins Bett.
Ich hatte ja gehofft, dass ich aufgrund zweier durchgeflogener Nächte sofort in einen Dornröschenschlaf fallen würde. Doch leider packte mich der Jetlag mit voller Wucht und von Schlaf war zunächst nicht die Rede. Im Laufe der Woche erlangte der Schlafrhythmus wieder Normalität, sodass es auch den Gedanken leichter fiel, wieder ganz in Deutschland anzukommen.
Jetzt bin ich schon wieder 2 Wochen in Deutschland und bin weitestgehend mit dem Kopf wieder angekommen. Liebe Loide, Anfang Juni gibt es dann noch einen letzten, intensiven Blogeintrag zum „Leben danach“, denn einige Gedanken über meine Reise müssen sich erst noch in den nächsten Wochen setzen. Jamaika hat mich geprägt. Die USA sicherlich auch, nur nicht so intensiv wie Jamaika. Wie genau, das finde ich in nächster Zeit für mich heraus. Ihr dürft gespannt sein!
Also, jetzt wieder auf deutsch: Bis Bald!
P.S.: Wer diesen Blogeintrag wirklich komplett durchgelesen hat: Chapeau, Umärmel und herzlichen Dank!